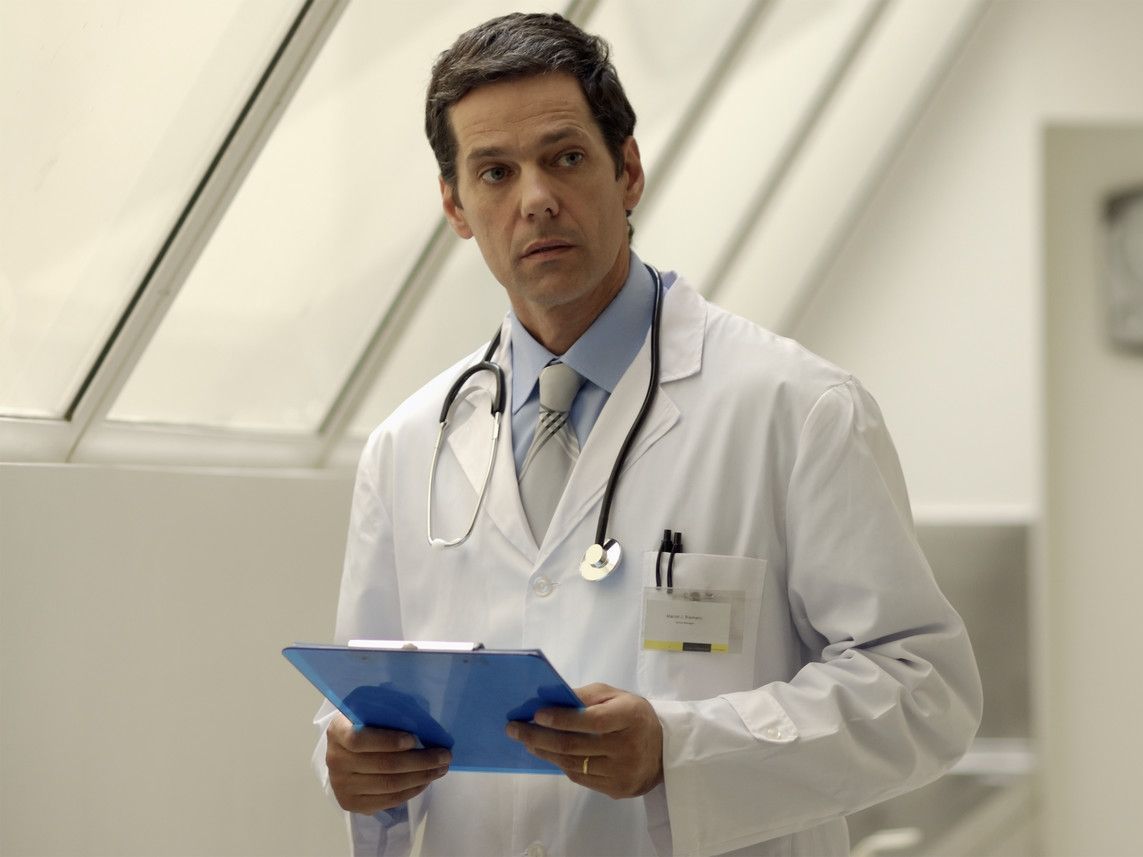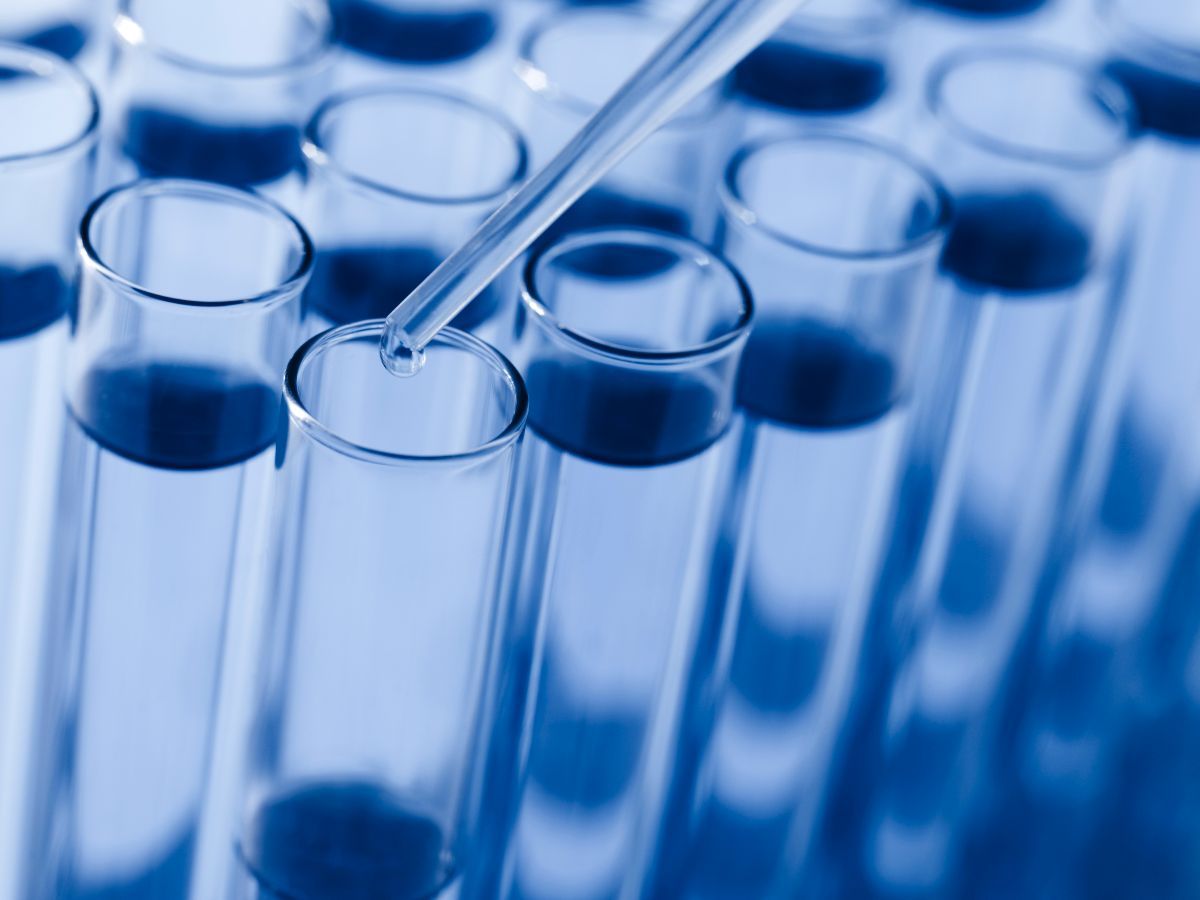KV-Zulassung: Der rechtssichere Weg in Ihre eigene Praxis
Ihr Schritt-für-Schritt-Leitfaden – von den Voraussetzungen bis zur ersten Abrechnung
Warum die KV-Zulassung der Schlüssel ist
Die KV-Zulassung öffnet Ihnen den Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung – und damit zur Behandlung gesetzlich Versicherter samt Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung. Ohne Zulassung bleibt allein die Privatpraxis, die in vielen Regionen wirtschaftlich nicht trägt. Mit Zulassung werden Sie Teil des Sicherstellungsauftrags und rechnen Ihre Leistungen strukturiert über die KV ab.
Rolle und Aufgaben der KV – Ihr operative Partner
Kassenärztliche Vereinigungen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie verhandeln Vergütung, rechnen Ihre Leistungen ab, zahlen Ihr Honorar aus, überwachen die vertragsärztlichen Pflichten und beraten bei Praxisführung und Abrechnung. Kurz: Die KV ist Schnittstelle zwischen Ihrer Praxis und den Krankenkassen – und damit zentraler Erfolgsfaktor für Ihren Praxisstart.
Zulassung vs. Ermächtigung – zwei Wege, unterschiedliche Reichweite
- Zulassung: Dauerhafte Berechtigung zur vertragsärztlichen Tätigkeit mit unternehmerischer Freiheit (Praxisgestaltung, Standort im Rahmen der Bedarfsplanung, langfristige Planung).
- Ermächtigung: Zeitlich/sachlich begrenzt (z. B. für Krankenhausärzte), abhängig von der Versorgungslage und jederzeit widerruflich. Für langfristige Praxiskonzepte bietet die Zulassung die höhere Planungssicherheit.
Voraussetzungen – was Sie vor Antragstellung benötigen
Facharztanerkennung ist zwingend. In der Allgemeinmedizin kommt regelmäßig ambulante Weiterbildung hinzu. Daneben zählen persönliche Eignung, gesundheitliche Zuverlässigkeit und Eintragung ins Arztregister. Für den Registereintrag brauchen Sie u. a.: Approbation, Facharztnachweis, Tätigkeitsnachweise, Führungszeugnis. Planen Sie mehrere Wochen Bearbeitungszeit ein.
Der Zulassungsausschuss – so überzeugen Sie das Gremium
Der Ausschuss ist paritätisch (Ärzteseite/Kassen) besetzt, den Vorsitz führt eine unparteiische Person. Neben den formalen Kriterien sind
Bedarfsplanung und lokale Versorgung ausschlaggebend. In überversorgten Gebieten gelingt die Neuzulassung meist nur via
Praxisübernahme; in unterversorgten Regionen bestehen bessere Chancen – teils mit Förderprogrammen.
Ihre Anhörung: Nutzen Sie die Einladung unbedingt. Präsentieren Sie Ihr Praxiskonzept, Versorgungsvorteile am Standort und belastbare Wirtschaftlichkeitsannahmen. Unterlagen geordnet, Antworten präzise, Ziele realistisch.
Drei Phasen zur KV-Zulassung
Phase 1: Vorbereitung
- Standort & Bedarfsplanung: Offen, gesperrt oder unterversorgt? Prüfen Sie die KV-Veröffentlichungen.
- Praxisübernahme vs. Neugründung: Übernahme bietet Patientenstamm und eingespielte Prozesse; Neugründung maximale Gestaltungsfreiheit, aber längere Anlaufzeit.
- Finanzierung: Investitionen, Anlaufkosten und Liquiditätsreserve realistisch kalkulieren; Bankgespräche früh führen
Phase 2: Antrag
- Formulare der zuständigen KV vollständig ausfüllen.
- Unterlagenpaket frühzeitig komplettieren: Lebenslauf, Fortbildungsnachweise, Arztregister-Bestätigung, Nachweise Praxisausstattung, Berufshaftpflicht; bei Übernahme Kaufvertrag/LOI, bei Neugründung Businessplan.
- Fristen: Ausschüsse tagen häufig quartalsweise. Einreichung in der Regel 6–8 Wochen vorher.
Phase 3: Nach der Zulassung
- Betriebsstättennummer und Abrechnungsgenehmigungen beantragen (z. B. Sono, Labor, Psychotherapie).
- Pflichten im Blick: Notdienst, Sprechstunden, Dokumentation, fristgerechte Abrechnung.
- Onboarding nutzen: Einführungsseminare der KV, Abrechnungs-Coaching, interne Prozessstandards.
Die häufigsten Fehler – und wie Sie sie vermeiden
- Unvollständige Unterlagen: Führen Sie eine Checkliste und haken Sie nachweisbar ab (insb. Fortbildung, Haftpflicht, Arztregister).
- Fristversäumnisse: Ausschusstermine rückwärts planen, interne Deadlines setzen.
- Schwache Anhörung: Konzept nicht „verkaufen“, sondern belastbar begründen – mit Daten zur Versorgungslage, Raum-/Gerätekonzept und Personalplanung.
- Fehlende Belege: Qualifikationen, Schwerpunktleistungen und ambulante Erfahrung müssen dokumentiert sein.
Flexiblere Einstiege: Teilzulassung & Job-Sharing
Teilzulassung (mind. 50 % Versorgungsauftrag) schafft Spielraum für Familie, Lehre oder Nebentätigkeit – mit entsprechend geringerem Honorarvolumen.
Job-Sharing ermöglicht geteilte Patientenversorgung und schrittweisen Übergang (z. B. mit Seniorpartner:in). Sorgfältige vertragliche Ausgestaltung ist Pflicht.
Alternative: Anstellung im MVZ
Das MVZ nimmt Ihnen Organisation, Abrechnung und Investitionsrisiko ab. Sie profitieren von geregelten Zeiten, verzichten aber auf unternehmerische Freiheit und den späteren Wert eines veräußerbaren Praxissitzes. Die Entscheidung ist eine Frage Ihrer Ziele: Sicherheit vs. Gestaltungs- und Vermögensaufbau.
Praxisnahe Tipps für einen reibungslosen Start
- Netzwerk: Frühzeitig Austausch mit Niedergelassenen in Ihrer Region.
- KV-Beratung: Kostenlose Niederlassungs-Sprechstunden konsequent nutzen.
- Zeitplan: Für das Gesamtverfahren realistisch 6–12 Monate ansetzen; Engpässe (Arztregister, Umbau, Geräte) einplanen.
- Prozesse: Ab Tag 1 strukturierte Termin-, Dokumentations- und Abrechnungsabläufe definieren.
Fazit – strategisch planen, rechtssicher umsetzen
Der Weg zur KV-Zulassung ist machbar, wenn Sie die formalen Voraussetzungen, Fristen und lokalen Versorgungsfakten konsequent managen. Erfolgsfaktoren sind: frühe Planung, vollständige Akten, realistische Wirtschaftlichkeitsannahmen und die Nutzung der Beratungsangebote. Die Zulassung ist der Start – die Qualität Ihrer Versorgung und Ihr Praxismanagement entscheiden über den langfristigen Erfolg.
Nächste Schritte mit arztpraxisrecht.de
- Kostenfreie Erstorientierung: Wir klären Ihren Beratungsbedarf und geben eine erste Orientierung
- Zulassungs-Paket: Erstellung und Komplettierung der Antragsakte, Terminkoordination, Coaching für die Anhörung, Check der Abrechnungsgenehmigungen.
- Praxisübernahme/Neugründung: Rechtliche Due Diligence, Kaufvertrags- und Mietvertragsgestaltung, KV-Ausschreibungsbegleitung, Praxis-Compliance (DSGVO, Medizinprodukterecht).
FAQ
Brauche ich zwingend eine Facharztanerkennung?
Ja. Die Facharztanerkennung ist Grundvoraussetzung. In der Allgemeinmedizin ist zusätzlich ambulante Weiterbildung üblich.
Wie lange dauert der Prozess?
Unterlagen, Ausschusstermine und ggf. Umbau/Übernahme führen realistisch zu 6–12 Monaten Laufzeit.
Geht Neuzulassung in gesperrten Gebieten? Frage
Regelmäßig nur durch Praxisübernahme bzw. Sitznachfolge. Alternativ: Teilzulassung oder Job-Sharing prüfen.
MVZ oder eigene Zulassung?
MVZ bietet Sicherheit ohne unternehmerisches Risiko. Die eigene Zulassung schafft Freiheit und ermöglicht Vermögensaufbau durch Sitzwert.
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Ob und wie eine KV-Zulassung im Einzelfall erreicht werden kann, hängt von Ihrer Qualifikation, der regionalen Versorgungslage und den konkreten Ausschussvorgaben ab. Lassen Sie Ihre Situation vor Entscheidungen prüfen.

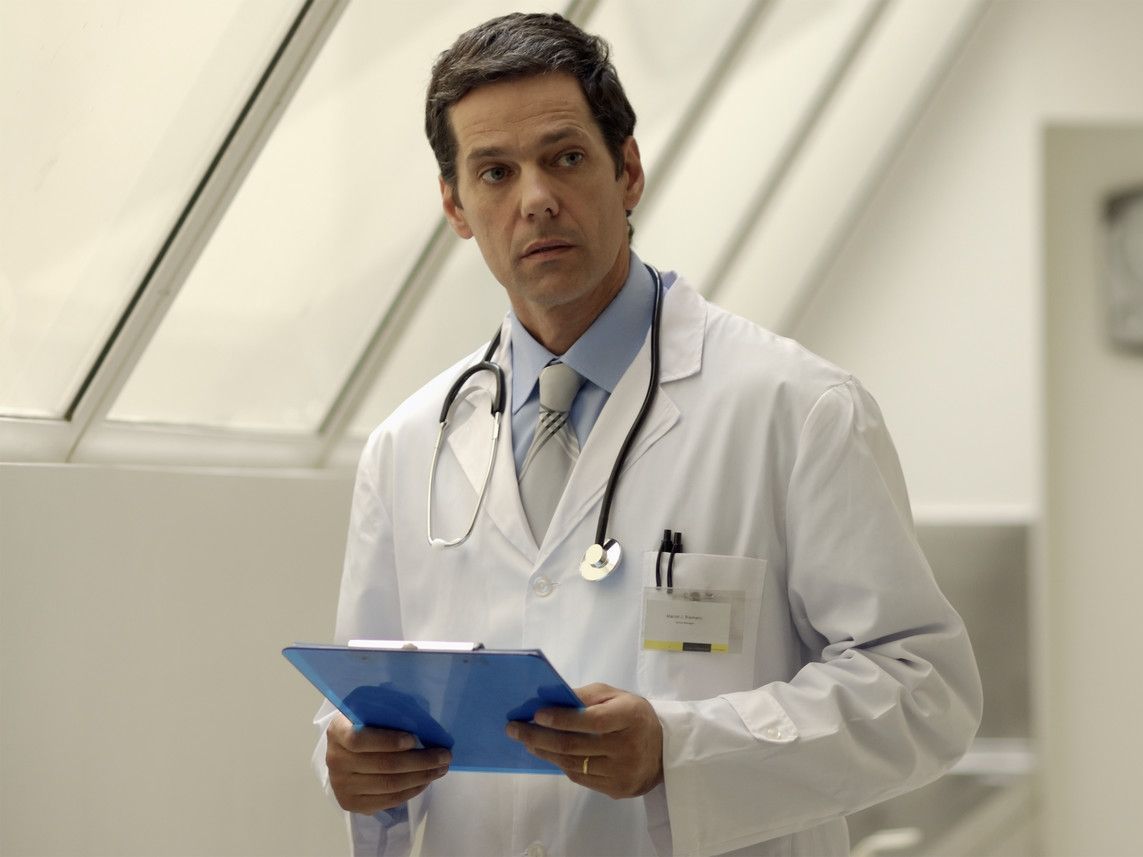
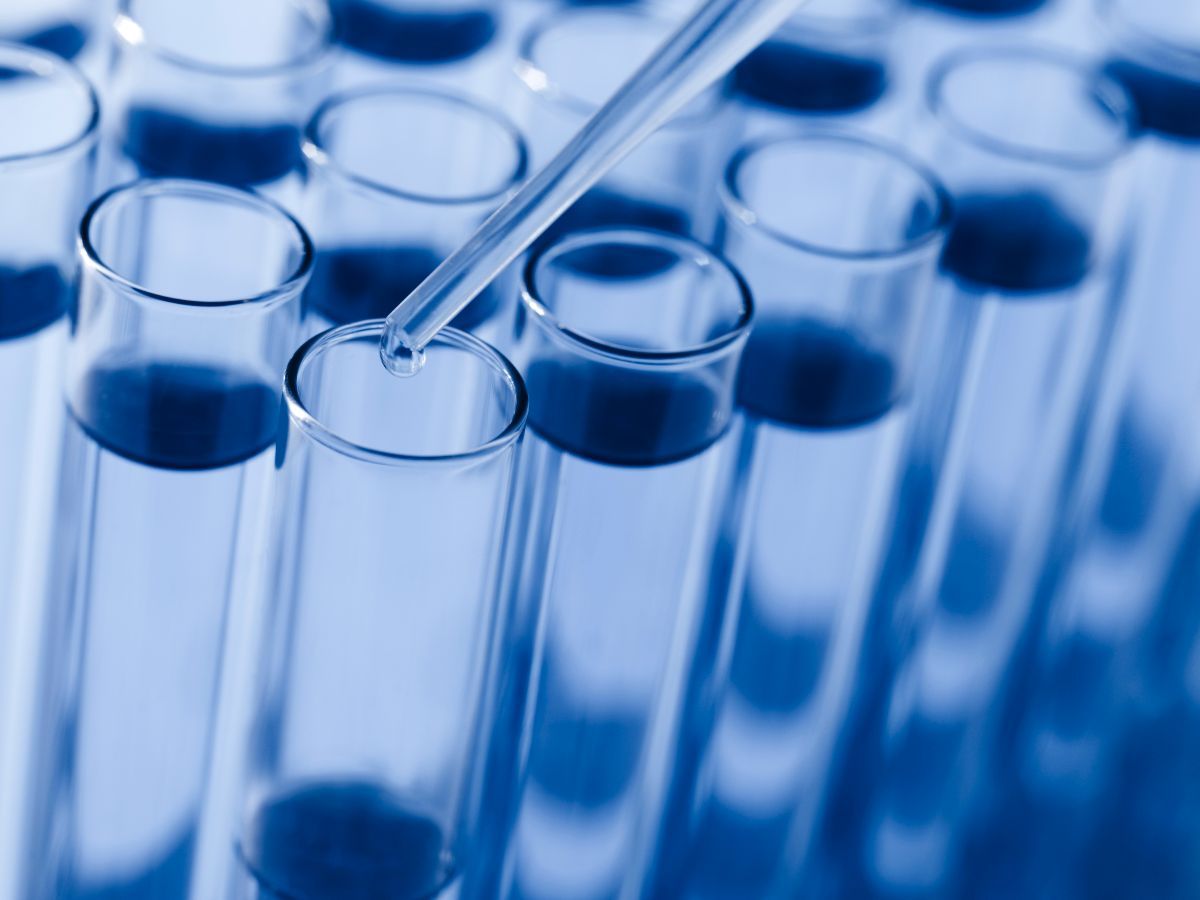
New-Health-Modelle in Deutschland – Chancen und rechtliche Herausforderungen für Ärztinnen und Ärzte